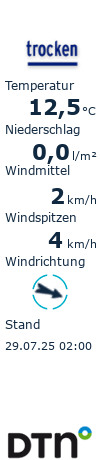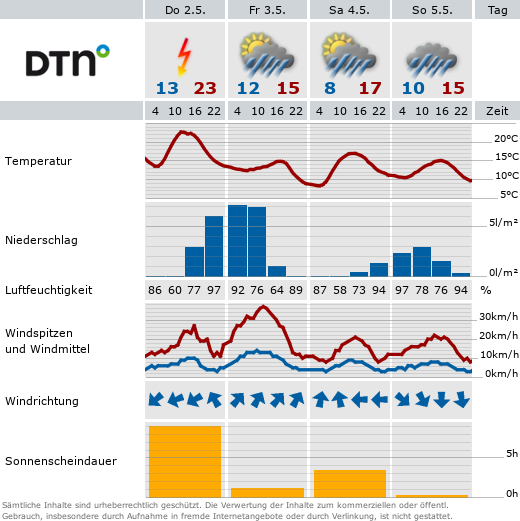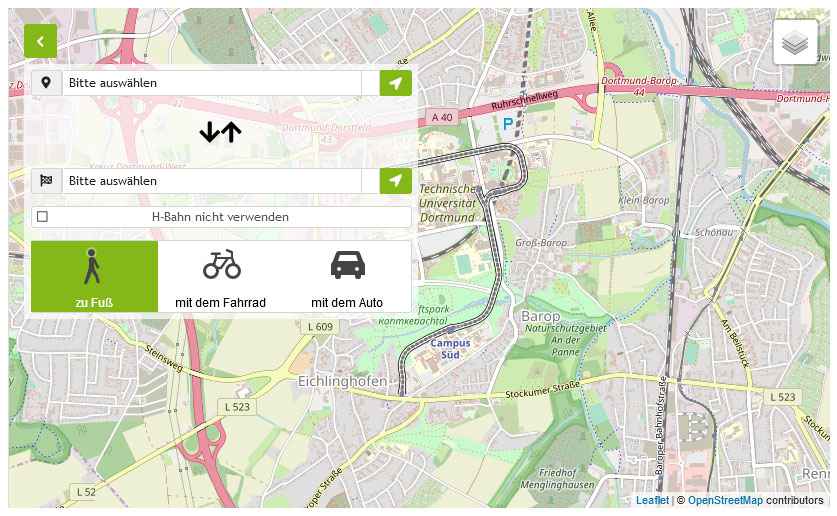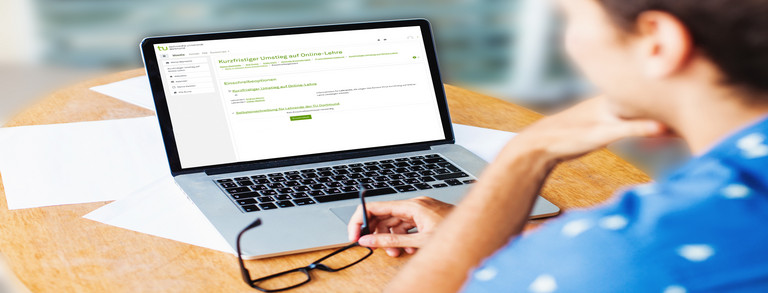Call zur Tagung: Urbane Resilienz in der Stadterneuerung
- Externe Meldungen

Call zur Tagung
Urbane Resilienz in der Stadterneuerung
Risikofaktoren, Methoden, Planungsinstrumente
Veranstalter*innen
Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen gemeinsam mit dem Fachgebiet Stadtplanung und Bestandsentwicklung der TU Berlin und dem Lehrstuhl Stadtplanung der RPTU Kaiserslautern-Landau in Berlin
Ort und Datum
11./12. Dezember 2025, Technische Universität Berlin, Campus Charlottenburg
Zielgruppen
Wissenschaftliche Fachtagung mit Praxisbezug für Studierende, Absolvent*innen, Promovierende, Forscher*innen und interessierte Praktiker*innen aus Verwaltung und Büros
Teilnahme nach Anmeldung kostenlos.
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
Tagungsthema
Klima, Krankheiten, Krieg und künstliche Intelligenz: Die aktuellen vier „globalen-K-Unsicherheiten“ unterstreichen die zentrale Rolle der Resilienz für die Stadterneuerung. Dabei ist das Verständnis von Resilienz ebenso umfassend und vielfältig wie die Herausforderungen selbst. Seit Einführung in die moderne Wissenschaft hat sich das Konzept der Resilienz von einer ökologischen Lehre über die Mechanik der Widerstandsfähigkeit in der Natur hin zu einem evolutionären, sozial-ökologischen Konzept entwickelt. Bezogen auf die gebaute Umwelt und städtische Gesellschaften wird vor allem die Anpassungs- und Entwicklungsfähigkeit betont. Dazu gehören unter anderem Werkzeuge, Methoden und Prozesse der Stadterneuerung. UN-Habitat definiert „Urbane Resilienz“ als ein dreifaches Konzept: der Schutz, die Anpassung sowie die Transformation von Städten.
Der Resilienzdiskurs in der Planung reicht von der Steuerbarkeit der Lebensumwelt bis hin zum Verständnis der Stadt als ein komplexes Funktions- und Infrastruktursystem. Die gebaute Umwelt ist zahlreichen Einflüssen ausgesetzt, die wiederum eigenen Dynamiken unterliegen. Für die Stadterneuerung bedeutet das, Resilienzansätze nicht nur als ein statisches Konzept zu sehen, sondern als ein adaptives und transformatives, das gleichzeitig Robustheit garantiert. Der Bestand mit seinem breiten Nutzungsspektrum soll als Lebensgrundlage und Ressource erhalten und weiterentwickelt werden. Der Diskurs unterstreicht dabei, dass Stadterneuerung sich nicht auf die Fortentwicklung von Bauwerken, Freiflächen und technischen Systemen beschränken kann, sondern soziale, kulturelle und politische Aspekte des Raums und ihre Widerstandsfähigkeit eine wichtige Rolle spielen.
Die Schwerpunkte der Tagung im Kontext von Stadterneuerung, Sanierung und Städtebauförderung zur Anpassung und Sicherung von Bestandsquartieren sind:
- Umgang mit Risiken in der integrierten Stadtteilentwicklung: Risiken der integrierten Stadtentwicklung wie der Klimawandel, soziale Ungleichheiten oder Haushaltsunsicherheiten prägen planerische Prozesse in Quartieren. Welche Strategien und Methoden liefert der Resilienzdiskurs, um diesen Herausforderungen zu begegnen?
- Urbane Klimaresilienz: Klimaanpassung und Klimaresilienz sind eng miteinander verwoben. Worin liegen gemeinsame Ansätze und worin Unterschiede im Rahmen der Stadterneuerung? Wie können Klimaanpassung und Klimaresilienz im Bestand verschränkt werden, um die Herausforderungen des Klimawandels zu bewältigen?
- Urbane Sicherheit und Zivilschutz: Die Gestaltung städtischer Räume wird immer mehr durch Sicherheitsbedenken geprägt, Anschläge und hybride Kriegsführung nehmen zu. Welche Bedeutung kommt der Resilienz für die Notfallplanung und den Zivilschutz zu? Wie können gestalterische und prozessuale Aspekte der Stadterneuerung mit den Zyklen des Katastrophenmanagements (Prävention, Vorbereitung, Bewältigung und Nachbereitung) verknüpft werden?
- Kritische Infrastrukturen: Kritische Infrastrukturen wie die Energie- und Wasserversorgung oder Verkehrssysteme sind integraler Bestandteil komplexer städtischer Systeme. Wie kann die Stadterneuerung dazu beitragen, Anfälligkeiten gegenüber Risiken zu reduzieren sowie Auswirkungen auf die Infrastrukturen zu minimieren?
- Mehrfachcodierung von Infrastrukturen: Infrastrukturen wie Hochwasserdeiche oder Wasserrückhaltebecken sind erforderlich, um Siedlungsräume vor den Auswirkungen des Klimawandels zu schützen. Gleichzeitig prägen sie das Stadtbild erheblich. Welche Strategien und Gestaltungsmöglichkeiten gibt es, um Infrastrukturen sowohl zur Stärkung städtischer Resilienz als auch zur Stärkung der Lebens- und Aufenthaltsqualität zu nutzen?
- Resilienter Stadtumbau: Die Bestandsentwicklung steht vor zahlreichen Herausforderungen: Klimawandel, strenge Regularien, steigende Kosten oder umfassende Aushandlungsprozesse. Was sind die Herausforderungen für einen „resilienten (Stadt-)Umbau“, der mit dem Ziel der Anpassungsfähigkeit stärker in den Bestand eingreift? Worin liegen Unterstützungsfaktoren und Hemmnisse? Welche Rolle spielt dabei die Redundanz von Infrastrukturen?
- Smart Cities: Digitale Werkzeuge und Tools nehmen zunehmend eine integrale Rolle bei der Entwicklung resilienter Städte ein, besitzen aber zugleich eine eigene, sich von den anderen benannten Systemen unterscheidende Vulnerabilität. Welche Potenziale und Risiken besitzt die Digitalisierung als Hebel in Transformationsprozessen der Stadterneuerung? Wie kann Digitalisierung intergierte Prozesse unterstützen?
- Steuerung und Teilhabe: Mit zunehmender Prozesskomplexität und Langfristigkeit der Zielsetzung steigt der Bedarf an iterativen und adaptiven Verfahren, zugleich wird es wichtiger, Expertenwissen einzubeziehen. Welche Formen institutioneller Steuerung und welche Kompetenzen werden hierzu benötigt? Welche Organisationsstrukturen sind geeignet, um disziplinäre Silos aufzubrechen? Wie kann Teilhabe und Mitverantwortung zu Resilienz in der Stadterneuerung beitragen?
Die Veranstalter*innen erwarten wissenschaftlich fundierte Beiträge, welche die Problemwahrnehmung schärfen, die Fachdebatte anregen und einen Beitrag zur grundsätzlichen Weiterentwicklung der Stadterneuerung und Bestandsentwicklung in Deutschland leisten. Für die Diskussion sind Beiträge zu aktuellen theoretischen Diskursen oder Einblicke in Methoden, Verfahren und Instrumente ebenso spannend wie wissenschaftlichen Fallstudien und Berichte aus der Planungspraxis. Sehr gerne kann die oft im nationalen Rahmen geführte Debatte ergänzt werden um internationale Beiträge – zum Beispiel aus Regionen mit starken Klimaveränderungen, Erdbebengebieten oder aus Kriegsgebieten.
Informationen zur Einreichung
Das Jahrbuch „Urbane Resilienz in der Stadterneuerung“ wird herausgegeben von Uwe Altrock, Grischa Bertram, Detlef Kurth, Jan Polívka und Renée Tribble.
Nach einer Auswahl durch die Herausgeber*innen des Jahrbuchs Stadterneuerung können ausgewählte Beiträge auf der Tagung in einem Vortrag vorgestellt werden. Anschließend besteht die Möglichkeit, den Beitrag im Jahrbuch Stadterneuerung zu veröffentlichen.
Bitte senden Sie Ihr Abstract (ca. 2.000-3.000 Zeichen) mit Angaben zu Ihrer Person (Kurzvita) bis zum 30. Juli 2025 an jbs-jahrestagung(at)isr.tu-berlin.de.
Verantwortlich für die Tagung und Ansprechpartner für Rückfragen sind: Detlef Kurth (detlef.kurth(at)ru.rptu.de) und Jan Polívka (jan.polivka(at)tu-berlin.de).
Die Einreichenden eines Abstracts werden bis zum 30. August 2025 über eine Annahme informiert.
Hintergrund
Seit 2008 veranstaltet der Arbeitskreis Stadterneuerung an deutschsprachigen Hochschulen jährlich eine Tagung zu wechselnden Fragestellungen zur Stadterneuerung. Weitere Informationen zum Jahrbuch Stadterneuerung und der Tagung sowie früheren Tagungen des Arbeitskreises finden Sie unter https://www.springer.com/series/14364 und https://de.wikipedia.org/wiki/Jahrbuch_Stadterneuerung